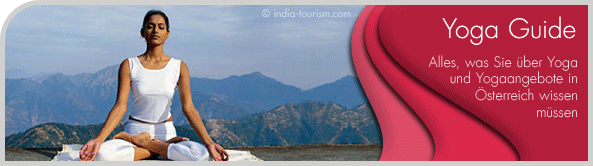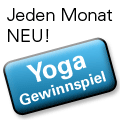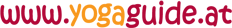Ein Lebenslauf
 Evelin Rosenfeld |
Von Peggy Mädler
Das Gespräch lässt mich seltsam euphorisch und zugleich etwas verwirrt zurück. Ich stehe auf der Straße, zünde mir eine Zigarette an und schüttle kurz den Kopf. Auf dem Weg zur S-Bahn kaufe ich Blumen, drei blassrosa Gerberas, dann setze ich mich in ein Café, um den ersten Eindruck aufzuschreiben. Das Erstaunen aufzuschreiben, bevor es die Zeit oder der Kopf in eine gewohnte Ordnung bringen.
Sie sagt zu Beginn des Interviews: Wir haben Zeit bis Fünf, reicht das?
Ich antworte lachend, das könne ich nicht beurteilen, ob ihr Leben in zwei Stunden passe. Später werde ich feststellen, dass es nicht ein, sondern mehrere Leben sind, die sie mir erzählt.
Was sich ändere, sei nicht der Inhalt, sondern die Form, die jeweiligen Mäntel, die sie sich überziehe, sagt Evelin R.
Geboren ist sie in Weingarten am Bodensee, aufgewachsen immer dort, wo der Beruf des Vaters die Familie gerade hinführte. Er habe Maschinenbau studiert und dann eine Managerkarriere in höchsten Positionen verfolgt. Die Mutter ist zunächst das, was Evelin R. eine typische Haus- und Ehefrau nennt. Doch dann, mit Anfang 40, legt sie ebenfalls noch eine erstaunliche Karriere hin, arbeitet erst als Assistentin in einem Verlag, um kurz darauf zur Chefredakteurin einer Zeitschrift aufzusteigen. Da war sie so alt, wie ich heute, sagt Evelin R. Sie erinnert sich an die Beziehungsprobleme der Eltern, an ihre eigenen Konflikte mit dem Vater.
Mit 13 Jahren wird sie in ein Mädcheninternat gegeben, Schwerpunkt Ballett. Und tatsächlich tanzen ihre Hände beim Reden, immer wieder schaue ich auf die feingliedrigen und zugleich kräftig wirkenden Finger mit den gepflegten Nägeln. Sie spricht weder laut noch leise, sondern klar. Die klare und pragmatische Stimme einer Naturwissenschaftlerin, denke ich mir. Und ich denke auch, dass das Mädchen Evelin, das man sehen kann, wenn sie lacht, wahrscheinlich schnell erwachsen geworden ist.
Mit 16 war sie vorbei – die Kindheit. Sie bricht mit dem Elternhaus, versorgt sich von da an selbst. Das war der Deal, meint sie. Der Vater hält sich raus und sie steht für ihr Leben selber ein. Sie macht das Abitur mit Bravour. Nebenbei arbeitet sie – bis vier Uhr nachts in einer Bar, um acht Uhr morgens geht es zur Schule, am Nachmittag kellnert sie wieder. In der kleinen Wohnung, die sie von dem selbst verdienten Geld bezahlt, stehen Zuchtgläser. Biochemie, Biotechnologie und Genetik – das sind die Fächer und Themen, die sie faszinieren.
Sie ist die idealtypische Studentin, wird von einem bekannten Professor der Biochemie betreut und gefördert. Sie ist begabt und ehrgeizig zugleich, träumt davon, für Erbkrankheiten prophylaktisch genetische Interventionen zu entwickeln. Das war die Idee, meint sie und diese knappe Bemerkung umschreibt Evelin R. besser als das Wort träumen.
Später wird sie über Werte, die ich Ideale nenne, in einer Weise sprechen, als seien sie das Ergebnis einer mathematischen Gleichung. Eins plus eins ergibt zwei. Sie träumt nicht, sie hat Ideen, die sie umsetzen will. Und sie hat Maßstäbe, sie führen zum ersten größeren Bruch in ihrer Biografie, wenn man den Bruch mit dem Elternhaus außer Acht lässt. Die Bezeichnung Bruch sei eine Bezeichnung, die aus der Beobachterperspektive komme. Der Begriff verweise auf eine von außen zunächst nicht nachvollziehbare Veränderung einer angenommenen Entwicklung.
Ich mag ihren analytischen Umgang mit Worten. Von innen betrachtet, kann ein Bruch zum roten Faden gehören, kann der Abbruch eines Studiums als Kontinuität empfunden werden. Sie wird doch nicht Biochemikerin, obwohl sie in ihrem Denken und Sprechen nach wie vor auch eine Naturwissenschaftlerin zu sein scheint. Unter anderem, unter vielem anderen wird sie in den nächsten Jahren einen Hof in Ostdeutschland aufbauen, sich mit chinesischen Heilmethoden und der makrobiotischen Ernährungslehre beschäftigen, ein BWL-Studium abschließen, drei Läden eröffnen und wieder verkaufen, die Privatisierungsmöglichkeiten der hessischen Verwaltung prüfen, das Überleben im Führungsstab eines Energiekonzerns als auch im thailändischen Dschungel erlernen, zwei Bücher schreiben und vieles anderes.
Es sind nicht nur verschiedene Leben, sondern vor allem verschiedene Denkweisen, die sie in ihrer Biografie vereint, die sie erkundet und auslotet, wie andere ihre unmittelbare Umgebung. Sie sagt, ich hätte doch sicherlich eine Struktur für das Interview. Ich nicke und lasse sie erzählen. Sie strukturiert sich selbst. Auch das ist präzise, an keiner Stelle wird sie ausschweifend.
Warum bricht eine erfolgreiche Studentin mitten in den Diplomprüfungen ihr Studium ab? Sie wird an einem Forschungsprojekt beteiligt und mit zunehmender Verantwortung kommen ihr Zweifel. Je mehr ich über das Projekt wusste, sagt sie und nimmt einen Schluck Kaffee, desto klarer wurde mir, dass wir in ein System eingreifen, dessen Zusammenhänge wir gar nicht begriffen haben. Da war diese Haltung - typisch für die Naturwissenschaften - extrem induktiv. Vom Kleinen aufs Große schließen, vom Besonderen aufs Allgemeine, ein geschlossenes System, das sich selbst begrenzt, meint Evelin R., irgendwann kommt man beim Elektronenmikroskop an, da ist der Blick für andere Ebenen oder Zusammenhänge schon verloren. However, das sei das Ende einer strahlenden Karriere gewesen.
Vielleicht ist es auch der Anfang einer ganz anderen Art von Karriere. Ihre Kritik des geschlossenen Systems scheint auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche übertragbar. Politik, Ökonomie, Kunstbetrieb, soziale Milieus – all diese Felder unterliegen internen Denk- und Sprechweisen, Regeln und Wahrnehmungsmustern und bringen sie gleichsam hervor.
Mir scheint, die Karriereleiter einer Evelin R. wächst nicht in die Höhe, sondern in die Breite, in die verschiedenen Welten hinein. Sie bricht die Prüfungen ab und geht in den Osten, in die Nähe von Oschatz, das sei kurz nach der Wende gewesen. Ihr damaliger Partner ist ein begnadeter Bauer, unter seinen Händen wächst und gedeiht einfach alles. Unter ihren Händen befrieden sich die Konflikte im Landkreis, mit 52 Interessensparteien haben sie es zu tun, als sie 1000 Hektar Land pachten. Da sind Alteigentümer, die im Rückeignungsprozess Ansprüche auf Flächen geltend machen, Kleinbauern, die nach Auflösung der LPGs eigene Betriebe gründen wollen und schließlich kommt noch die Treuhand hinzu. Wissen Sie, wie viel 1000 Hektar Land sind? Ich weiß es nicht. Um 1000 Hektar zu bewirtschaften, brauche man rund eine Million. Sie haben damals 8000 DM. Ihr gelingt es, Banken zu überzeugen. Sie sucht den Kontakt zu den Dorfbewohnern - Stunden haben wir uns von den Familien und dem Land erzählen lassen, sagt sie und nennt es Integration. Später kamen Investoren, denen die Geschichte und Sichtweisen der Bewohner egal waren. Da brannte schon mal die Ernte eines Zugezogenen. Ich vermag mir nur schwer die damals 23jährige vorzustellen. Jugendlicher Leichtsinn war es auch, meint sie heute. Zur Aussaat gibt es noch keine Rechtssicherheit, sie wissen nicht, ob sie jemals ernten dürfen.
Das Risiko zahlt sich aus, ihr damaliger Partner ist inzwischen ein wohlhabender Mann. Und Sie? In der Beziehung kriselt es. Die Mutter stirbt, eine Freundin verschwindet in Amerika. Auch dem Vater geht es schlecht, sie kümmert sie sich um ihn. Ich frage nicht, wie sie das zwischen 1000 Hektar Land und 52 Interessensparteien auch noch geschafft hat. Ich war völlig überarbeitet, meint sie, als könne sie meine Gedanken lesen, fast schon depressiv. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer Freundin und findet sie in einer kleinen Gemeinschaft in den Bergen von Massachusetts, die nach der makrobiotischen Ernährungslehre lebt. Dort hört sie auch einen Vortrag von Michio Kushi. Im Internet finde ich später Texte und Bilder von ihm, er sei ein wichtiger Vertreter der Makrobiotik, heißt es. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften betreibt er einen der ersten Naturkost-Vertriebe in den USA, begründet mehrere Stiftungen, schreibt zahlreiche Bücher. Das Wort Ernährung wird in einem Atemzug mit Gesundheit und Weltfrieden genannt. Evelin R. schüttelt anfangs den Kopf darüber, zeigt sich skeptisch, ja belustigt und schließlich doch beeindruckt von Kushis Vorstellungen.
Sie wird seine Assistentin, begleitet ihn auf Vorträgen. Das war die bewusste Aktivierung meiner spirituellen Ebene, sagt sie und ich merke, dass es meinem Kopf Mühe bereitet, den Blick der kritischen Naturwissenschaftlerin mit der spirituellen Weltsicht zusammen zu denken. Sie habe sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt, meint sie - Philosophie, Diagnostik und verschiedene Heilverfahren der chinesischen Medizin, es sei wie ein Erinnern gewesen. Dabei unterscheide sich die fernöstliche Logik sehr vom westlichen Denken. Nach einem dreiviertel Jahr kehrt sie nach Deutschland zurück, will mit dem Gelernten etwas anfangen, etwas Eigenes aufbauen.
Sie sei von Natur aus keine Anhängerin. Dann schon eher eine Kauffrau. Eine sehr freudvolle und dynamische Kauffrau, sagt sie und lacht. Und weil es sich gezeigt hat, dass sie eher größere Projekte interessieren, absolviert sie zunächst noch ein BWL-Studium und eignet sich die Prämissen und Regeln des Wirtschaftens an. Eine nächste Welt im Kopf der Evelin R. Neben dem Studium arbeitet sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse - das sind die grauen Männer in den grauen Anzügen – sagt sie, in den nächsten Jahren trägt sie selbst solche Anzüge. Sie liebt Zahlen und Finanzrechnungen. Ihre Diplomarbeit schreibt sie über Unternehmensbewertungen. Das herkömmliche Analysemodell, das sich primär auf die Börsenwerte eines Unternehmens bezieht, erweitert sie um die Kategorie der instinktiven Entscheidungen. Ihr Vater habe immer den Kopf geschüttelt, wenn sie von ihren wissenschaftlichen Modellen schwärmte. Da wollte sie es wissen: Bauchentscheidungen versus wissenschaftliches Supermodell, das habe ziemliches Aufsehen erregt. Sie bekommt lukrative Angebote: als Analystin für die WestLB, als Wirtschaftsprüferin bei Price Waterhouse. Sie schlägt die Angebote aus und landet bei einer Unternehmensberatung. Nein, korrigiert sie sich. Vorher bin ich erst mal gescheitert.
Da war ja noch der Traum, einen makrobiotischen Handel in Deutschland aufzubauen, sagt sie und verwendet nun doch dieses Wort träumen. Das Konzept, das sie am Neujahrsmorgen 1998 schreibt, nennt sich Natural Food Concept und beinhaltet eine Cateringküche, den Handel mit chinesischen Heiltees und Seminare. Sie bekommt eine halbe Million von zwei Banken. Sie eröffnet drei Läden: in Berlin, in Hamburg und in Frankfurt. Sie arbeitet mit zwei Partnern zusammen und diese stellen sich binnen kürzester Zeit als ungeeignet für die jeweiligen Verantwortungsbereiche heraus. Sie formuliert die Probleme vorsichtig, bedachtsam. Sie sagt: Ich war in Schwierigkeiten.
Das war ein Tief, eine Lebenskrise, sie sagt auch: Ich habe wirklich Angst gehabt. Bis dahin habe sie nichts bremsen können. Plötzlich sieht sie das Risiko, die Möglichkeit der Verschuldung – und fällt vom Pferd. Der Sturz ist schmerzhaft. Es gelingt ihr, das gerade erst gesattelte Pferd zu verkaufen und den Kredit auszulösen – von der Eröffnung der Läden bis zum Verkauf vergeht nicht mal ein ganzes Jahr. Ein unglaubliches Tempo, sage ich überrascht. Ein Wunder, sagt sie. Ich würde heute noch abbezahlen, wenn es anders gelaufen wäre. Wenn man vom Pferd fällt, muss man gleich wieder rauf, heißt es. Sonst wird die Scheu, die Angst immer größer. Der Sturz prägt sich ein, im Grunde hindert mich das bis heute, sagt sie.
Ich sehe Evelin R. beim Schreiben dieser Zeilen vor mir, wie sie mit angezogenen Beinen auf der Couch sitzt, sich ab und an das braune, leicht gelockte Haar zurückstreicht. Sie wirkt elegant und unbefangen zugleich. Zum schwarzen Rock trägt sie einen hellblauen Wollpullover, an den Ohren kleine, dezente Perlenstecker.
Ohne die Erfahrung des Scheiterns wäre sie wahrscheinlich größenwahnsinnig geworden. Das behauptet ihr Vater. Könnte sein, sagt sie. Andererseits sei sie in den letzten zehn Jahren viel zu risikoavers gewesen. Da arbeitet sie als Unternehmensberaterin und reformiert unter anderem die hessische Verwaltung. Im Grunde wieder eine ganz andere Welt, sie habe damals viel über Politik gelernt. Prüfen Sie die Privatisierungsmöglichkeiten von hoheitlichen Aufgaben – so lautete der Auftrag. Unter SPD-Regierung, im Übrigen. Sie schmunzelt oft. Die Verwaltungen hatten keine Zahlen oder sie lieferten keine Zahlen, wer arbeitet schon gern an der eigenen Abschaffung mit.
Die 30-jährige Beraterin entkoppelt das politische Motiv aus dem Projekt und sucht nach einer Sachebene für alle Beteiligten. Macht Kommunikationsprobleme, gemeinsame Interessen deutlich. Team-Empowerment nennt sie das heute. Ihr Modell überlebt den nächsten Regierungswechsel und wird zur Vorlage für Privatisierungsoptionen in Verwaltungen. Als sie mein Unbehagen angesichts des Wortes Privatisierung bemerkt, schiebt sie nach: Es gehe darum, Gemeinwohl mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Mein Unbehagen bleibt, auch wenn solcherart Schlagwortverbindungen längst selbstverständlich scheinen.
Ein Paradigmenwechsel, hinter dem kaum mehr zurückzudenken ist. Als Ende der 90er Jahre die Liberalisierung des Strommarktes beschlossen wird, bekommt Evelin R. das Angebot, im Führungsstab eines großen Energiekonzerns mitzuarbeiten. Es bauten sich gerade drei Mächte auf, erzählt sie, RWE, E.ON und EnBW. Ihr Chef hatte es sich in den Kopf gesetzt, die vierte Kraft im Osten zu werden. Als sie den Energiekonzern wieder verlässt, gibt es Vattenfall Europe. Der Weg dahin war anstrengend und gleichzeitig genial, meint sie. Aber damals habe sie auch verstanden, dass man bestimmte Sachen nicht von innen heraus verändern kann, nicht als Teil des Systems. Ich muss an die gerade beschlossene Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke denken. Evelin R. denkt an etwas anderes, erinnert sich an erbitterte Macht- und Territorialkämpfe in den Führungsetagen. Da waren lauter alte Herren und kein Licht mehr, sagt sie. Nur noch Wut, Resignation, Stumpfheit. Wenn unreflektierte Gefühle zum Motiv für wichtige Entscheidungen werden, dann sei das unendlich schädlich für das gesamte System. Es habe ihr auch Leid getan, dass sich da Menschen, die offensichtlich viel Potential haben, von ihren Verletzungen und Frustrationen so verleiten lassen.
However. Wieder dieses Wort: However - als wäre das „Wie auch immer“ rückblickend zugleich Abschied und Auftakt für etwas Neues. Für eine nächste Entscheidung. Für eine neue Perspektive.
Als sie in dem Energieunternehmen anfängt, sagt sie dem Vorstand: Nach dem Projekt werde ich gehen. Und tatsächlich fühlt sie sich danach erschöpft, ausgebrannt. Um sie von ihrer Kündigung abzubringen, verdoppelt der Konzern ihr Gehalt, ihre Mitarbeiter, ihre Arbeitsausstattung binnen einer Woche zweimal.
Sie kündigt dennoch, reist nach Thailand. Und bleibt für ein paar Monate. Sie dürfen sich das so vorstellen, sagt sie, dass ich die überwiegende Zeit allein in einem Holzhaus im Dschungel gelebt habe. Eine alte Thai lehrt sie, mit Skorpionen, Kobras und den heftigen Monsunregenfällen umzugehen. Regen ist nicht gleich Regen. Evelin R. kommt zur Ruhe, betrachtet ihr bisheriges Leben und sucht den roten Faden, der die vielen Welten im Kopf verbindet. Ich habe eine Antwort gefunden, sagt sie. Eine Berufung, wenn Sie so wollen.
Nach ihrer Rückkehr schreibt sie ein Buch mit dem Titel: Was dir wirklich wichtig ist. Ein Arbeitsbuch zum Personal Empowerment. Wertbasiertes Management und Unternehmensverantwortung – das sind ihre Themen, wenn sie heute als freie Beraterin arbeitet. Ihr ist klar, dass diese Begriffe oft nicht mehr als Worthülsen sind. Luftnummern, sagt sie dazu. Für sie sind sie Lebensinhalt und der rote Faden. Sie wolle den Kern sichtbar machen, sagt sie, herausfinden, was für Menschen oder Unternehmen identitätsstiftend ist, und dazu beitragen, dass das maßstäblich wird - im Gegensatz zu zweckrationalem Handeln oder kurzfristigen Einzelinteressen.
Ob es da nicht eine Kluft gebe, frage ich sie, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen ihrem Verständnis von Ethik und Verantwortung und der internen wirtschaftlichen Logik von Unternehmen? Ein Unternehmen bestehe ja auch nur aus Menschen, antwortet sie. Das Denken dieser Menschen verändere sich bereits, das sei kein Ideal, sondern ein realer Prozess, der gerade auf vielen Ebenen stattfinde. Mitarbeiter kommen an ihre physischen und psychischen Grenzen, suchen nach Lösungen, um mit dem Druck umzugehen, mit einem Wachstumsbegriff, der primär leistungs- und gewinnorientiert ist und vielen sozialen Normen und Werten entgegenläuft.
Sie sehe zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Spannung, der Widerstand gegen diesen Wachstumsbegriff so groß, dass das System nicht mehr funktionieren kann, sich öffnen muss und damit auch ein Paradigmenwechsel stattfindet. Dafür setze sie sich mit aller Kraft ein.
Und die andere Möglichkeit?, frage ich. Das System wird enger, noch grausamer. In Bezug auf politische, soziale wie ökonomische Entwicklungen. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit der beiden Möglichkeiten sei wohl gleich hoch. Es ist ihre Pragmatik, die Selbstverständlichkeit im Umgang mit den verschiedenen Welten, ja selbst noch mit dem roten Faden, die mich während des Gespräches so anregt, fasziniert und zugleich auch etwas verwirrt. Dass sie Denkweisen und Perspektiven zusammenbringt, die mir selbst viel widersprüchlicher scheinen. Mich erstaunt ihre Sachlichkeit, mit der sie Strukturbedingungen wie Wertvorstellungen beschreibt. Es gibt Fakten und Möglichkeiten. Es gibt Hypothesen.
Wer wird sie in fünf Jahren sein? Ich habe keine Ahnung, aber viele Vorstellungen. Gerade ist sie dabei, ihren Lebensmittelpunkt nach Teneriffa zu verlagern. Dort hat sie ein Projekt mit arbeitlosen Jugendlichen initiiert, in dem diese eigene Betriebe für den Anbau von alten Medizinpflanzen aufbauen. Außerdem wolle sie eine Zeitlang das Coaching mit Einzelnen stärken, die grauen Anzüge ablegen und öfter wieder Bergstiefel anziehen. Während des Gespräches werde ich den Eindruck nicht los, dass sie mit jedem Gegenüber eine Andere sein könnte. Wenn ein Mensch viele Türen in sich hat, Türen zu verschiedenen Welten, dann hat sie vielleicht genau überlegt, durch welche Tür sie mich hineinlässt.
Die Begegnung mit Teneriffa war einer dieser Zufälle, an die ich nicht glaube, sagt sie an einer Stelle des Interviews. Sicher ist es kein Zufall, dass ich vor allem über die Naturwissenschaftlerin in ihr nachdenke. Vielleicht sollte die Kulturwissenschaftlerin in mir doch noch mal Physik studieren. Oder sich wenigstens als Gasthörerin einschreiben. Literatur und Quantentheorie. Die Lust am Weltensammeln kenne ich. Und auch das Gefühl, mitunter in keiner der Welten so richtig beheimatet zu sein.
- Blog von Seminarreisen
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben